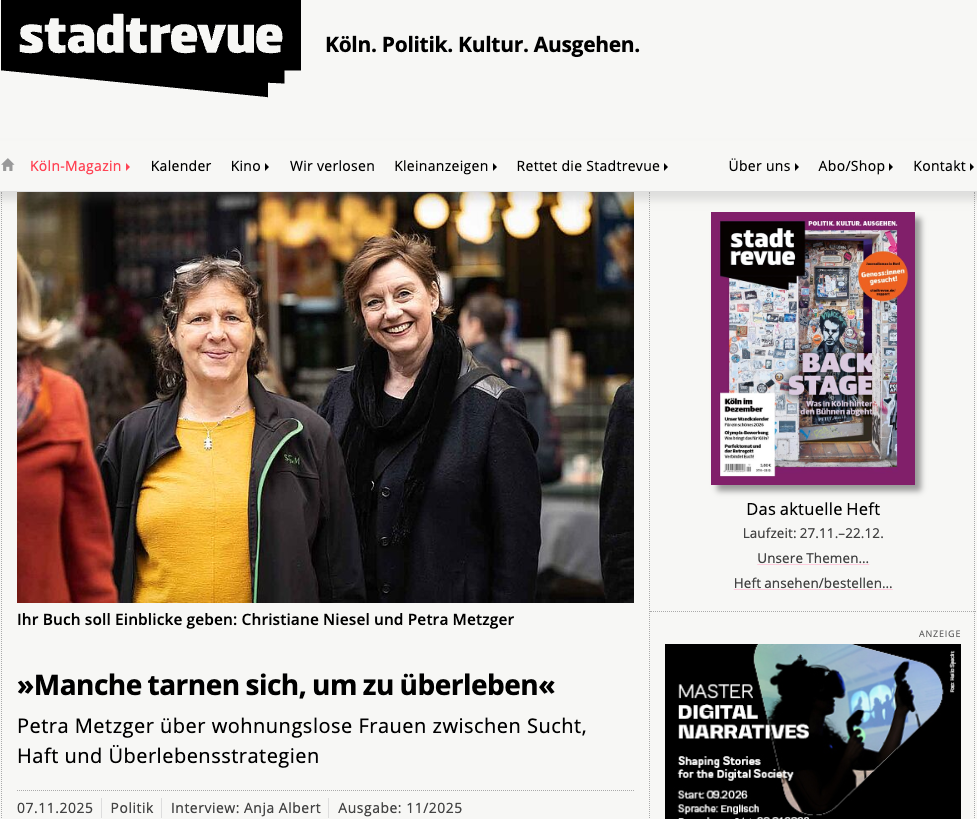Obdachlosigkeit bei Frauen
Von Susanne Esch 01.12.2025, 11:00 Uhr
Mit 14 drogensüchtig, obdachlos und kriminell – nach Haftstrafen ist sie heute clean. Ihren Ausstieg schildert sie im Buch „Frauen zwischen Straße und Strafe.“
Kathis Drogenkarriere begann im Alter von 14 Jahren mit einer Heroin-Zigarette. Sie bekam sie von einer Freundin in der nahegelegenen Großstadt, wo sie häufiger unterwegs war, seitdem sie die Schule schwänzte. Der eigentliche Kipppunkt in ihrem Leben lag allerdings schon vorher: der Tod ihrer Großmutter. Kathis Mutter arbeitete in einem Kiosk und kam immer abends erst spät zurück, der Vater, der als Lkw-Fahrer arbeitete, war nur am Wochenende da. Und so wuchs Kathi bei der Großmutter auf. „Sie war wie meine Mama für mich. Sie war mein Ein und Alles“, erzählt Kathi, die eigentlich anders heißt, in einem Interview.
Es ist eines von acht Gesprächen, die die Kölnerin Christiane Niesel mit weiblichen Obdachlosen geführt und mit Petra Metzger in einem Buch veröffentlicht hat: „Frauen zwischen Straße und Strafe“ thematisiert schwierige Lebenssituationen, die sich bedingen: Obdachlosigkeit und Gefängnisstrafe. Wie schnell das eine zum anderen führt, wird in den Interviews deutlich.
Ein Schicksalsschlag und die folgende Sucht
Der Einstieg in die Abwärtsspirale ist oft ein Trauma oder ein Schicksalsschlag, wie bei Kathi. Sie verlor den Halt nach dem Verlust ihrer wichtigsten Bezugsperson. Das ständige Schulschwänzen bedingte mehrfache Schulwechsel. Die Endstation: eine Einrichtung für schwererziehbare Kinder. Kathi flüchtete sich in die Drogen, haute von zuhause ab und landete auf der Straße. Zum Heroin kam Kokain. Das Geld reichte nicht. So wurde Kathi kriminell.
Als sie im Alter von 14 Jahren das erste Mal in Jugendarrest kam, war das Strafregister bereits lang: Diebstähle, Drogenhandel, Drogeneinfuhr, Schwarzfahren, auch Körperverletzung. Sie hatte die Verkäuferinnen einer Parfümerie geschubst, wo sie vor Regen Schutz gesucht hatte. Die beiden hatten sie aufgefordert, den Laden zu verlassen. Sie habe randaliert, gibt Kathi im Interview zu, sie sei auf Entzug und aggressiv gewesen. Auf den ersten Jugendarrest folgten fünf weitere.
Neue Straftaten kamen hinzu. Die erste längere Haftstrafe verbüßt sie im Alter von 17 Jahren in der JVA Ossendorf. Gerade auf freiem Fuß – wurde sie wieder straffällig. „Da ich mit wenig Geld in die Obdachlosigkeit entlassen wurde, habe ich wieder Straftaten begangen“, schildert Kathi, „und wieder Drogen genommen.“ Erneut in Haft habe sie zwei Jahre gebettelt, in das Programm „Therapie statt Strafe“, aufgenommen zu werden und eine stationäre Drogentherapie in einer suchttherapeutischen Einrichtung zu erhalten.
Die Gefängnisleitung erlaubte aber nur die Verlegung in eine andere Gefängnisabteilung, in der Abhängige auf eine Therapie vorbereitet werden. Kathi weigerte sich: „In dieser Abteilung waren damals mehr Drogen unterwegs als in allen anderen“, erzählt sie. So erhielt sie eine ambulante Therapie, die Therapeuten wechselten ständig. Die Therapie scheiterte.
Mit Unterstützung gelang Kathi der Ausstieg
Kathi gelang am Ende dennoch der Ausstieg aus dem Pendeln zwischen Straße und Strafanstalt, nachdem sie in eine offene Gefängnisabteilung für Langzeitstrafen gewechselt war, wo sich die Rahmenbedingungen für sie verbesserten. Sie kam dort mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut klar, nahm an Sport- und Fitnessprogrammen teil, machte eine Therapie, einen Entzug, ihren Hauptschulabschluss, mit jeweils einer Eins in Mathe und Deutsch. Kathi lernte dort auch ihren Freund kennen. Ihr Freund hatte Rückhalt bei seinem Chef. Der gab dem jungen Mann nach dem Gefängnis und Entzug wieder Arbeit, stellte auch Kathi als Reinigungskraft an und besorgte dem Paar eine Wohnung.
Mittlerweile ist Kathi 27 Jahre alt und clean. Ihr Gespräch mit Christiane Niesel im Buch gibt tiefe Einblicke in Lebens- und Haftbedingungen, die Menschen retten oder tiefer in die Sucht treiben können. Co-Autorin Petra Metzger hat eines oft erlebt: Häufig sind es einzelne Menschen, die den Unterschied machen. Sie beleuchtet im Buch in weiteren Texten, woran es oft hapert, die Hindernisse im Hilfesystem, sinnlose Haftaufenthalte und fehlende Resozialisierung. Die Autorinnen zeigen zudem auf, wie Betroffenen besser geholfen werden könnte.